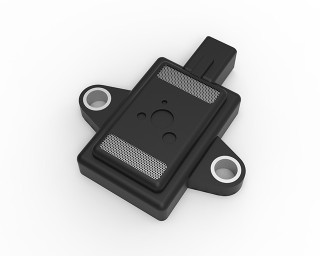Die Effizienz von Batteriespeichersystemen zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren – das war das Ziel des Verbundprojekts »COOLBat«, an dem insgesamt 15 Forschungseinrichtungen und Industriepartner gemeinsam arbeiteten. Durch neuartige Materialien und Verfahren sollten die Lebensdauer und Leistung von Batterien verbessert werden. Wir sprechen heute mit Hannes Lefherz, Mitarbeiter am Fraunhofer IST, über das Vorhaben und die Rolle das Fraunhofer IST im Konsortium.
mehr Info